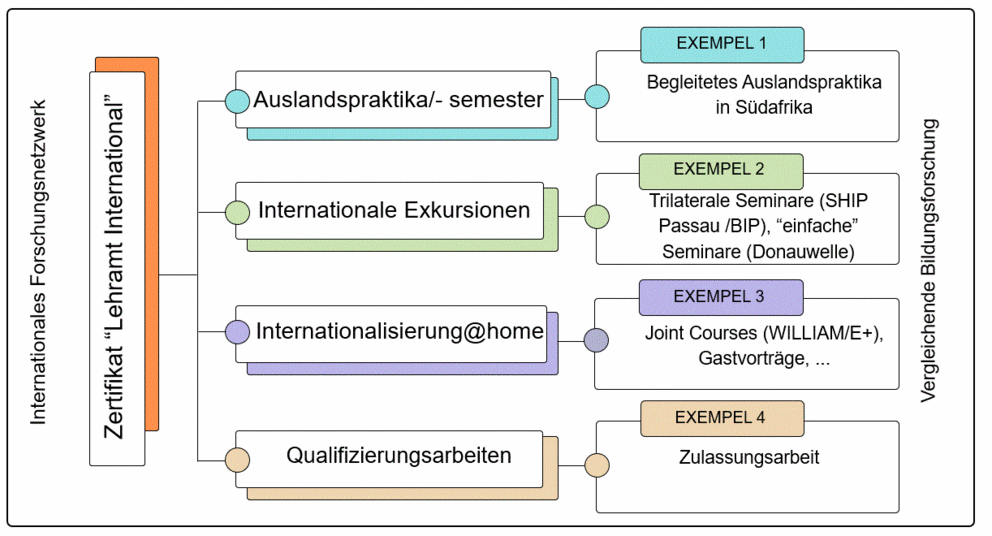Internationalisierung der Lehrkräftebildung
Gesellschaftliche Transformationen und sich entsprechend wandelnde Anforderungen an Bildungsinstitutionen machen eine stringente Internationalisierung der Hochschulen unabdingbar (vgl. Massen et al. 2023), die neben physischer Mobilität u. a. auch die Internationalisierung der Curricula oder die Etablierung einer internationalen Campus-Kultur adressiert.
Diese Internationalisierung geht angesichts unterdurchschnittlicher Mobilitätsquoten an der Kohorte der Lehramtsstudierenden offenbar weitgehend vorbei (vgl. HRK, 2015; Kercher & Schifferings 2019, S. 239-249; Stifterverband für die Deutsche Wissenschaft 2015, S. 54-55).
Mögliche Ursachen:
- unzuverlässige Anrechnungspraxis
- mangelnde curriculare Verankerung
- wenige bis keine Mobilitätsfenster
- Charakteristika des Lehrkräfte-Arbeitsmarkts
Dabei könnte insbesondere die Lehrkräftebildung Internationalisierung nutzbar machen, um jene professionsbezogenen Kompetenzen und eine globale Handlungsfähigkeit zu vermitteln, die das berufliche Handlungsfeld von Lehrkräften im 21. Jahrhundert erforderlich machen. Internationale Erfahrungen im Kontext der Professionalisierung von Lehrkräften setzen nicht nur voraus, dass Studierende den Lehrberuf bereits als akademische Profession wahrnehmen, sondern bergen bezüglich der Anbahnung einer pädagogischen Professionalisierung explizite Chancen - beispielsweise hinsichtlich der Entwicklung „transformativer Kompetenz“ (Mezirow, 1997) und der dafür erforderlichen Reflexionsräume (weiter Informationen hierzu: Profigrafiemodell nach Hansen 2017).
Die diversitätssensible, inklusive Eröffnung eben dieser Reflexionsräume steht im Kern der Internationalisierungsstrategie der Lehrkräftebildung an der Universität Passau. Dabei setzen wir an den erwähnten Desideraten an und nutzen die zur Verfügung stehenden Mobilitätsfenster und curricularen Anbindungsmöglichkeiten insbesondere für fachlich eng begleitete Gruppenangebote sowie für die Implementierung vielseitiger internationaler Erfahrungen am Passauer Campus. Bei Information und Beratung setzen wir verstärkt auf den Peer-to-Peer-Austausch zwischen Absolvent*innen und Interessierten.
Folgende Formate stehen Ihnen zur Verfügung:
Ansprechpartner*innen:
Prof. Dr. Christina Hansen, christina.hansen@uni-passau.de
Dr. Kathrin Eveline Plank, kathrin.plank@uni-passau.de